
Wie Nadelstiche: Rassismus im Alltag
Wie Nadelstiche: Rassismus im Alltag
Alltag läuft mal mehr, mal weniger routiniert. Alltägliches wird bewältigt, Alltag ist bekannt, vertraut und sicher, vielleicht sogar berechenbar, ein tägliches Einerlei, ein gleichförmiger Ablauf. Er ist für die meisten Menschen also vorhersehbar, struktur- und möglicherweise haltgebend. Etwas, was in der Schnelligkeit der Welt für Klarheit und Berechenbarkeit sorgen kann, manchmal vielleicht sogar Langeweile auslöst, unaufgeregt ist, vielleicht auch monoton. So würden wahrscheinlich viele Menschen Alltag beschreiben – und das ist ein Privileg.

Die befragten Frauen verfügen nicht über dieses Privileg. Alltag besteht für sie aus kräftezehrenden Herausforderungen. Für sie lauern im Alltag zahlreiche Situationen, die diese unvorhersehbar und bedrohlich machen. Von einem Moment zum nächsten werden sie durch rassistische Kommentare und Beleidigungen aus ihrem vermeintlichen Alltag herausgerissen. Die Studie zeigt, dass Menschen mit (familiärer) Migrations- und Fluchtbiografie sich in ihrem Alltag in MV mit Anfeindungen und Bedrohungen auseinandersetzen müssen. Die interviewten Frauen berichten von Situationen, in denen sie unbeschwert Alltägliches bewältigen und von einem Augenblick zum nächsten ihre Routinen erschüttert werden.
Du läufst durch die Straße, Schnee überall, alles ist wunderschön, alle sind draußen und machen Fotos. Du siehst nur lächelnde Gesichter, und dann läuft ein Mann hinter uns und sagt: ‚Guck mal, die Kanaken.‘
Personen, die Rassismen produzieren, bewirken mit eben diesen, dass Betroffene eine permanente Unsicherheit erleiden müssen. Diese Strategie ist sehr wirkmächtig. Die befragten Frauen schildern eindrücklich, dass sie sich dadurch in ihrem Alltagserleben extrem eingeschränkt fühlen. Sie berichten von zahlreichen Bedrohungsszenarien, die ihnen den Zugang zum öffentlichen Raum verwehren.

Diese Angst gehört für sie zum Alltag dazu und wird fast beiläufig in die Tagesplanung integriert: Wo gehe ich Lebensmittel einkaufen? An welcher Haltestelle steige ich aus? Auf welchem Spielplatz können meine Kinder spielen? Der Besuch von Spielplätzen oder Einkäufe und andere Erledigungen werden für sie zur Bedrohung. Personen, die Rassismen produzieren, setzen Beleidigungen und Bedrohungen ein und erzeugen damit eine Umgebung der Angst und Gefahr. So berichtet eine Mutter von einer besonders gefährlichen Begebenheit:
Es war ein schöner, sonniger Tag. Die Kinder spielten Fußball. Dann kam eine Gruppe von Jugendlichen, die waren älter als meine Kinder. Auf einmal fingen sie an, die Kleinen zu bedrohen: ‚Ihr müsst zurück, ihr Scheißausländer. Ihr müsst zurück in eure Heimat, ihr habt hier nichts zu suchen, wir brauchen euch nicht hier.‘ Von diesem Erlebnis haben mir meine Kinder zunächst nichts berichtet. Am nächsten Tag gingen sie wieder Fußball spielen. Da wurde es noch schlimmer: Sie wollten da nur spielen und wurden sogar mit einem Auto verfolgt. Sie wurden beinah überfahren! Eine Stunde lang sind diese jungen Menschen mit einem Auto hinter meinen Kindern hergefahren, meine Kinder sind weggerannt und die immer hinterher! Als sie nach Hause kamen, waren sie fast ohnmächtig, sie konnten nicht mehr, sie konnten kein Wort sprechen vor Angst.

Andere Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern, die Hijab tragen, berichten darüber, dass sie auf offener Straße ausgelacht oder beleidigt werden. Die Frauen geben an, dass sie nur in seltenen Fällen am öffentlichen Leben teilnehmen können, ohne bewertet oder beleidigt zu werden. Sie schildern, dass ihnen Beleidigungen hinterhergerufen, sie bespuckt werden und mit rassistischen Fragen konfrontiert sind. Sie können sich nicht frei oder unbeschwert bewegen – der Alltag wird zum Spießrutenlauf.
Soziale Distanz und Ausgrenzungserfahrungen führen zu Leidensdruck. Neben direkten rassistischen Beleidigungen und Bedrohungen ist Ablehnung ständige Wegbegleiterin der befragten Frauen. Sie berichten darüber, dass sie teilweise ignoriert werden, wenn sie Auskunft erbitten oder eine Frage haben. Viele Frauen berichten, dass der erlebte Alltag in Mecklenburg-Vorpommern damit verbunden ist, „zur Anderen, zur Fremden“ gemacht zu werden. Sie erleben, dass sie nicht zur Mehrheit gehören und aus dem sozialen Umfeld ausgeschlossen werden, egal, wie sehr sie sich individuell anstrengen. Freundschaften zu schließen oder Bekanntschaften zu machen, wird für sie zur enormen Herausforderung. Durch die permanenten Ausgrenzungserfahrungen entsteht eine soziale Distanz. Diese Distanz mindert Vertrauen und perpetuiert Fremdheit.
Die Interviews zeigen auf, dass diese Distanz für Betroffene nur schwer zu überwinden ist. Die daraus folgende Anstrengung liegt allein auf den Schultern der Frauen: Sie müssen sich ständig offenbaren, rechtfertigen, erklären und verteidigen. Ihr Alltag ist davon bestimmt, Wege und Strategien für einen möglichen Umgang zu finden. Sei es die Akzeptanz, dass sie einfach nicht dazugehören sollen, oder eine Überangepasstheit, um ja nicht aufzufallen oder anzuecken.
Nach all den Jahren, die ich nun schon hier lebe: Mein Akzent bleibt nach wie vor, ich werde ihn nicht los. Die Menschen weisen mich immer und immer wieder darauf hin. Egal, wie sehr ich es versuche, ich gehöre nie dazu.
Alltagsrassismus, das fühlt sich an wie kleine, unvorhersehbare und unerwartete Nadelstiche, die permanent verletzten – diese Metapher formulierte eine der Interviewpartnerinnen. Mikroaggressionen, die den Alltag von Betroffenen torpedieren: kurze und alltägliche Demütigungen, in der Kommunikation und im Verhalten, die entweder absichtlich oder unabsichtlich feindliche, abwertende oder negative rassistische Kränkungen und Beleidigungen beinhalten und stets Gefahr laufen, unentdeckt zu bleiben und verharmlost zu werden. Die Gefahr dieser Nadelstiche liegt darin, dass sie schwer zu erkennen sind und oft im Unsichtbaren bleiben, nicht nur für die Ausführenden, sondern auch für die Betroffenen.
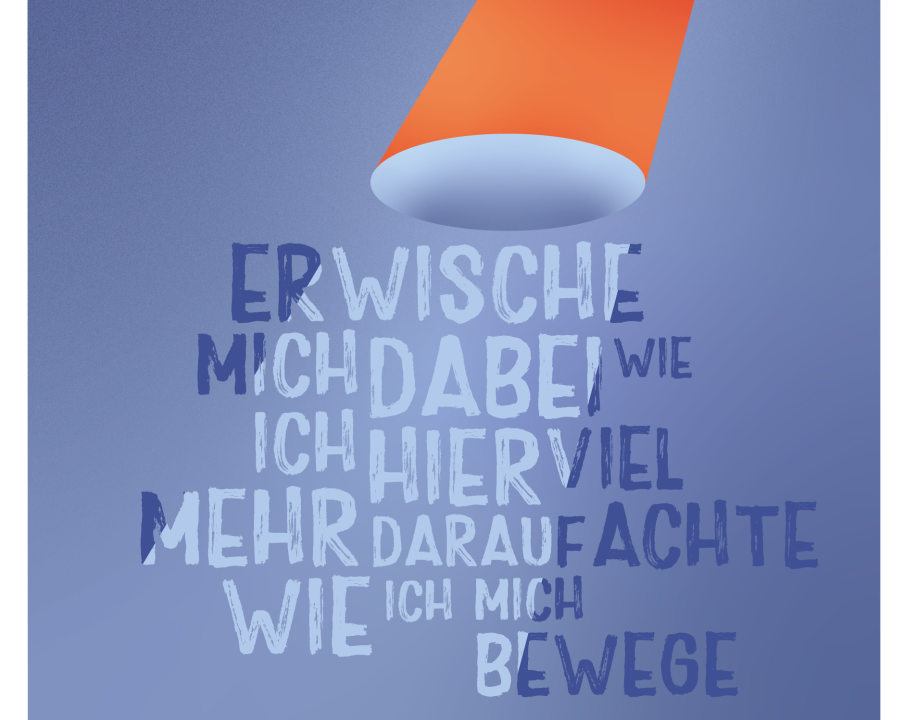

Die Grenzen des (Un)Sagbaren: Sprache
Die Grenzen des (Un)Sagbaren: Sprache
Migrationsprozesse sind mit Sprechen und Sprache aufs Engste verbunden. Wenn Menschen ihre Heimatregion dauerhaft oder für eine gewisse Zeit verlassen und sich ein neues Zuhause über Ländergrenzen hinweg neu aufbauen, verändert sich die Art und Weise des Sprechens.
Die Gründe und Anlässe einer sprachlichen Alltagspraxis sind immer vielfältig. Biografische Möglichkeiten und Entscheidungen sind in Strukturen eingeschrieben bzw. durch gesellschaftliche Gegebenheiten geformt. Viele Menschen, die sich über Ländergrenzen auf den Weg machen, sind herausgefordert, ihren Alltag in einer neuen Sprache zu gestalten und zu bewältigen. Die Teilnehmerinnen der Studie erzählen über verschiedene Beweggründe für ihre eigene oder familiäre Migration – die je individuelle Sprachpraxen hervorbringt. Vereint sind die Frauen jedoch in ihrem Bestreben um Zugehörigkeit und Anerkennung als Person und als Mitglied der Gesellschaft – auch durch Mittel der Sprache.
Mehrsprachigkeit – (wieder) ein Zukunftsthema?
Die meisten der interviewten Frauen sind mit verschiedenen Sprachen aufgewachsen und vertraut, wie auch mehrerer Sprachen und/oder Dialekte mächtig. Kinder und Jugendliche in Mecklenburg-Vorpommern, deren Eltern oder Großeltern nicht in Deutschland geboren sind, wachsen in den meisten Fällen mehrsprachig auf. In den Erzählungen von Frauen über ihre mehrsprachige Kindheit und Jugend in Mecklenburg-Vorpommern wird eine Unterscheidung zwischen der Sprache im familiären Kreis und in der öffentlichen Sphäre deutlich.
Die Frauen berichten über Spott, herablassende Blicke, Diskriminierung und Gewalt, die sie erfahren, wenn sie sich in öffentlichen Räumen nicht auf Deutsch äußern. Sie gewöhnen sich an, in der Öffentlichkeit nur noch Deutsch zu verwenden – aus Selbstschutz und um ihre Kinder und Angehörigen zu schützen. Zahlreiche mehrsprachigen Menschen sind in ihrem Alltag darum bemüht, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und ein angepasstes Bild in der Öffentlichkeit zu präsentieren, das besonders gute Deutschkenntnisse beinhaltet.
Also mein Gefühl ist, ja, ich habe tatsächlich auch letztens meine Mutter mal gefragt, weil ich so das Gefühl hatte, sie war so die typische überangepasste Polin hier, das ist ja für Polen in Deutschland nicht unüblich. Aber zum Beispiel, sie hat immer Polnisch mit uns gesprochen, also das war zum Beispiel etwas, das hat sie nicht versteckt. Da gibt es ja wirklich Familien oder so, die haben versucht, da wirklich nur Deutsch zu sprechen. Also wir sind tatsächlich zweisprachig aufgewachsen. Sie hat viel Polnisch mit uns gesprochen und ihr war das auch immer wichtig, dass wir das können. Aber ich hatte das Gefühl, meiner Mutter war es immer sehr wichtig, was wir nach außen für ein Bild abgeben.

In den Erzählungen der Frauen finden sich vielfach Erfahrungen wieder, wie ihre Kinder im Alltag mit der eigenen Mehrsprachigkeit umgehen und sie diese mit ihren Eltern verhandeln:
Wenn ich mich auch auf dem Spielplatz mit anderen Eltern auf Deutsch unterhalte, dann drehe ich mich zum Kind und rede auch Deutsch. Und dann, schlimm, oder nicht am schlimmsten, aber traurig fand ich, als ich mit meinem Kind in der Kita im Umkleideraum war und ihm irgendetwas auf Russisch gesagt habe, und er sagte dann zu mir ganz leise auf Deutsch: „Mama, die anderen verstehen dich doch nicht, red´ doch Deutsch.“ Das fand ich, genau, dass es von ihm aus kam, fand ich schade. Und ich weiß, dass meine Mutter zum Beispiel, (…) hat mir erzählt, als sie einmal mit ihm, mit dem Kind gespielt hat, dass zu ihr dann eine Frau gesagt hat, sie soll doch Deutsch mit dem Kind reden.
Familien bemühen ein vermeintlich angepasstes, an den deutschen Normalitätserwartungen orientiertes Bild, woran das eigene Handeln im Öffentlichen ausgerichtet wird. Ein ständiges Hinterfragen geltender Normvorstellungen gilt aus der Sicht vieler Frauen nicht als erstrebenswert – auch im Berufsalltag nicht. Einige Frauen entscheiden sich gegen die Möglichkeit, die eigene Muttersprache im beruflichen Zusammenhang zu nutzen.
Sich im beruflichen Kontext auf Arabisch, Dari, Farsi, Russisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch oder Griechisch zu äußern und zu behaupten – die Reaktionen auf ihre Mehrsprachigkeit beschreiben die Frauen als kompliziert und konflikthaft. Sie berichten über Situationen, in denen sie rassistisch beleidigt oder benachteiligt wurden, weil sie in ihrer Muttersprache gesprochen haben. Um sich so im Berufsalltag selbst zu schützen, entscheiden sich viele Frauen dafür, ihre Muttersprache nur noch im Privaten zu benutzen.
Der Begriff Geheimsprache kam auch öfter vor, als ich telefoniert habe, auf Ungarisch telefoniert habe. Und ja. Also sie hat einfach mit mir nicht auf der gleichen Augenhöhe gesprochen. Und zum Beispiel die anderen Aushilfen, die waren deutsche Aushilfen, sie durften schon nach ein paar Wochen auch Kasse machen. Ich hab da zwei Jahre gearbeitet und ich durfte nie die Kasse machen. Wirklich nie.
Die Erfahrung, in Alltagssituationen aufgrund der Nutzung ihrer Herkunftssprache, ausgeliefert und in der eigenen Handlungsmächtigkeit eingeschränkt zu sein, verbindet viele der Frauen in Mecklenburg-Vorpommern. Solche Episoden können zu Diskriminierung, Ausgrenzung und psychischen Notsituationen führen, die bei Nichtadressierung – fehlende Thematisierung, psychosoziale Beratung, ärztliche Behandlung bei Bedarf – weitreichende Folgen haben können.
Fehlende Worte in der Schule – Sprachpraxis und formaler Bildungserfolg
Mehrere Frauen berichten, dass ihnen Lehrkräfte wegen Sprachbarrieren in der Grundschulzeit nicht zugetraut haben, ein Gymnasium zu besuchen. Die Nichterteilung von Gymnasialempfehlungen hat viele Mädchen ausgebremst. Manche Frauen berichten mit Dankbarkeit von Einzelpersonen – oft die Mutter oder die Cousine –, die ihren Bildungsweg auch dann unterstützt haben, wenn dieser ihnen vom restlichen Umfeld nicht zugetraut wurde.
Ich glaube, ich habe halt wirklich das meiste meiner Mutter zu verdanken. Alleine, dass ich zum Beispiel aufs Gymnasium gekommen bin. Da haben damals alle gestaunt, ja, und für meine Mutter war das dann: „Natürlich, selbstverständlich geht die aufs Gymnasium.“ Und als ich das irgendjemand erzählt habe in der Grundschule, haben die Eltern über mich gelacht. Meine Deutschkenntnisse waren nicht so gut, teilweise. Und vielleicht auch einfach, weil sie ja meine Mutter kannten oder so, und die Deutschkenntnisse auch nicht so gut waren und dann so nach dem Motto: „Das wird die nie schaffen.“ Also und dieses nur, weil man ja irgendwie was nicht perfekt kann oder halt vor allem Sprache, wird man ja oft immer so abgestempelt, als hätte man dann auch nicht so einen hohen IQ.
Aus den Erzählungen der Frauen geht hervor, dass Schule für die meisten von ihnen keinen geeigneten Ort darstellte, um über Rassismuserfahrung zu sprechen. In Auseinandersetzung mit den früheren schulischen Erfahrungen wird in manchen Passagen der eigene kindliche oder jugendliche Umgang mit Rassismus im Rückblick neu verhandelt:
Ich hab zum Beispiel in der Schule keine rassistischen Erfahrungen gemacht, die mir jetzt bewusst sind. Ich hab keine Ahnung, ob ich Sachen einfach, ja, gelöscht hab aus meinem Gedächtnis. Das kann gut sein. Aber da wurden solche Themen einfach gar nicht besprochen. Das war auch nicht gut. Also es wurde nie über Rassismus gesprochen, es wurde aber auch nie über meine Herkunft gesprochen. Es wurde einfach komplett weggeschwiegen, und zwar damit so getan, als wenn ich dazu gehöre, aber auf so eine ganz komische Art und Weise, die auch nicht gut war. Also die mich dazu, also das hab ich, das ist eine Erfahrung, die ich auch in meinem migrantischen Freundeskreis, die wir ähnlich aufgewachsen sind in Schwerin, im ähnlichen Alter gemacht hab, dass wir teilweise unsere Identität einfach verschwiegen haben, dass manche Jungs teilweise so getan haben, also sich deutsche Namen gegeben haben, ich mit meinen Freunden bis heute Deutsch nur rede, weil wir nicht miteinander Arabisch gesprochen haben. Und solche Sachen. Also es war auch nicht gut.
Schüler:innen mit einer Migrationsbiografie erleben die Nichtthematisierung von Herkunft und Zugehörigkeit als Leerstelle. Fehlt es bei Lehrkräften und Mitschüler:innen an einem respektvollen und interessierten Umgang, fällt es betroffenen Schüler:innen schwer, Zugehörigkeitsangebote anzunehmen, mögen diese auch vorhanden sein.
Als Reaktion auf die (Nicht-)Thematisierung von Identität, Zugehörigkeit, Rassismus oder Diskriminierung, entwickeln Kinder und Jugendliche mit einer (familiären) Migrationsbiografie vielerlei Strategien. Sie verschweigen sogar ihre ethnische Identität in der Schule, geben sich „deutsche Namen“ und nutzen die gemeinsame Fremdsprache nur untereinander, um wie die anderen zu sein – und „nicht aufzufallen“.

Ja, ja genau, aber ich glaube, bis zur dritten Klasse hat sich das dann schon soweit entwickelt gehabt, das geht ja dann, gerade bei Kindern (…). Irgendwann ist das ja immer so, dass es, wenn bestimmte Sachen aufgearbeitet wurden, dass es dann relativ schnell geht. So hat das meine Mama auch beschrieben, also quasi super lang sehr stumm, fast nichts gesagt und dann irgendwann war dann so von einem Tag zum anderen wie ein Wasserfall, bis heute.
Mehrere Frauen berichten über schulische Probleme aufgrund von sprachlichen Defiziten: Ihnen fehlte es an Worten, um Freundschaften schließen zu können, sie erinnern sich an Schwierigkeiten beim Lernen zurück, die sich zum Teil erst Jahre später legten. Viele der Frauen, die eine Ausbildung abgelegt oder studiert haben, berichten über einen konflikthaften Schulalltag, in dem sie Ausgrenzung, Zurückweisung und auch Gewalt ausgesetzt waren:
Das war wirklich anders von Realschule zum Gymnasium, deswegen war das viel schwerer. Die haben das nicht verstanden. Ich hab immer noch Probleme mit der deutschen Sprache, da ich kaum Deutsch rede. Ich hab wirklich null Freunde in der Schule. Ich rede wirklich kaum, deswegen, und, also um Sprache zu lernen, muss man viel reden, deswegen hatte ich auch viele Probleme in der Schule, immer noch. Aber ich wurde auch mehrmals beschimpft, also richtig Schimpfwörter, was man nicht sagen darf eigentlich.
Unter den hier benannten „Probleme[n]“ finden sich rassistisch motivierte Beleidigungen und Beschimpfungen, die nicht weiter beachtet oder pädagogisch aufgefangen wurden. Auch berichten Frauen darüber, dass ihnen Sprachdefizite im Deutschen generalisierend als Fehler oder Mangel ausgelegt werden. Sie berichten über schulische Erfahrungen, in denen ihnen selbstverständliche Alltagskompetenzen und sogar geistige Fähigkeiten abgesprochen werden.

Unsichtbare Mauern: Institutionelle Diskriminierung
Unsichtbare Mauern: Institutionelle Diskriminierung
In den Erzählungen der Frauen werden immer wieder Ungleichbehandlungen in Ämtern und Behörden abgebildet. Menschen mit (familiärer) Migrationsgeschichte haben es, auch in MV, nachweislich schwerer, Wohnraum zu finden oder sich erfolgreich auf eine Stellenausschreibung bzw. auf einen Ausbildungsplatz zu bewerben. Das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass sie auf Individuen stoßen, die diskriminierende Praktiken vertreten, sondern auch damit, dass sie auf Verwaltungsstrukturen treffen, die diskriminierendes Handeln ermöglichen oder gar befördern.
Frauen aus Mecklenburg-Vorpommern berichten, dass sie als Hochqualifizierte bereit sind, sich als unqualifizierte Arbeitskraft einstellen zu lassen, um in den Status der Erwerbstätigkeit zu gelangen. Andere verfügen über Ressourcen und studieren in MV erneut – auch nach abgeschlossenen Studiengängen und nach einer ersten beruflichen Expertise im Herkunftsland –, oft in einem ganz anderen Fachgebiet. Die Frauen erleben nicht nur eine Entwertung ihrer akademischen Abschlüsse und beruflichen Erfahrungen in Deutschland, sondern ihre Migrationserfahrungen münden in Deklassierungserfahrungen, da sie im Vergleich zur Lebenslage im Herkunftsland in schwächere sozioökonomische Positionen gelangen.
Ich bin eine hoch ausgebildete Frau. Ich habe studiert, und ich habe drei Sprachprüfungen absolviert, und trotzdem muss ich in einem Hotel die Teller abwaschen.
Wenn über diskriminierende und ausgrenzende Strukturen gesprochen wird, die unsere Gesellschaft durchziehen, fällt es häufig schwer zu benennen, was Menschen, die gesellschaftlich als „anders“ und „fremd“ markiert werden, erfahren oder womit sie konfrontiert sind. Auch Frauen mit Migrationsgeschichte erleben Verwaltungshandeln nicht als neutral. Sie sind ohnehin mit mehrfacher Diskriminierung im Alltag konfrontiert, die innerhalb diskriminierender Strukturen umso wirkmächtiger sein dürfte. Der Kontakt mit zahlreichen unterschiedlichen Institutionen und Ämtern ist für sie schlicht unvermeidbar, insbesondere wenn es Kinder in ihren Familien gibt.

Eigentlich fühlte ich mich hier wohl, also am Anfang. Obwohl Rassismus immer ein Thema war. Aber bei mir ist es halt schlimmer geworden, als ich angefangen habe, Kopftuch zu tragen. Dann habe ich vieles erlebt, es ist Alltag für mich geworden, dass mich Leute auf der Straße beschimpfen. Und jetzt hab ich Schwierigkeiten, weil ich ja meinen Abschluss im Sommer bekomme. Und bis jetzt habe ich keine Ausbildung gefunden, weil ich immer Absagen bekomme wegen dem Kopftuch. Oder sie sagen nichts. Wenn ich Vorstellungsgespräch habe, gucken die Personen mich so komisch an und verunsichern mich.
Frauen berichten auch über Ausgrenzungen auf dem Wohnungsmarkt. Sie sind konfrontiert mit rassistischen Aussagen, Diskriminierungen wegen des Nachnamens oder des Umstands, alleinerziehend zu sein. Die rassistische Dimension geht dabei sehr weit: Zum einen berichten Frauen, dass bereits die Angst, sich zu bewerben, sehr groß sei und auch permanent bestätigt wird. Sie sind mit rassistischen Stereotypen bezüglich ihrer (zugeschriebenen) Herkunft oder fehlender Transparenz in der Wohnungsvergabe konfrontiert. Wenn dann weitere Diskriminierungsdimensionen relevant werden, bspw. das Merkmal, alleinerziehend zu sein, wird die Wohnungssuche zu einem unmöglichen Unterfangen
Also ,ich bin alleinerziehend, das heißt, ich suche eine Wohnung für meinen Sohn und mich. Als Frau mit diesem Nachnamen in Rostock, der größten Stadt des Bundeslandes, ist es fast unmöglich. Ich habe eine Anstellung, ich verdiene Geld. Aber ich bin chancenlos auf dem freien Markt. […] Bei Telefonaten muss ich beispielsweise Auskunft darüber geben, wo mein Name herkommt. Ich komme dann meistens nicht mal bis zur Besichtigung. Oder ich bekomme einen Termin zur Besichtigung, und plötzlich ist die Wohnung dann aber doch schon weg.
Besonders erschütternde Ergebnisse wurden im Bereich der medizinischen Versorgungen erhoben. Betroffene Frauen berichten von massiven Ausgrenzungs- und Diskriminierungserlebnissen. Dies fängt bei rassistischen Zuschreibungen an. Frauen berichten, dass allein aufgrund ihres Nachnamens das medizinische Personal ihnen absprach, Deutsch sprechen zu können. Daraus resultierte bei einigen Frauen, dass sie in die medizinische Versorgung nicht vollständig mit eingebunden wurden und es zu fehlenden Absprachen kam. Und selbst in der vulnerablen Situation von Krankheit und der daraus resultierenden Hilfsbedürftigkeit sind Frauen nicht davor geschützt, rassistische Bedrohungsszenarien zu erleiden:
Als ich schwanger war, musste ich mehrmals ins Krankenhaus. Ich lag mit einer deutschen Frau in einem Zimmer. Dann kam eine Krankenschwester in das Zimmer, sie war wohl frisch aus dem Urlaub zurück, ich kannte sie noch nicht. Ich lag im Bett mit meinem Kopftuch, und sie hat gedacht, ich verstehe kein Deutsch. Sie dreht sich zu der deutschen Patientin und sagt: ‚Soll ich Sie von der befreien und in ein anderes Zimmer stecken? […].‘ Das war ganz schlimm.
Schließlich ist der Ausschluss vom Wahlrecht für zugewanderte Menschen ohne deutsche Staatsbürger:innenschaft und die damit verbundene fehlende Repräsentanz in politischen Einrichtungen maßgeblich für die Stabilisierung diskriminierender Strukturen. Ein Blick in die Kommunalverfassung von Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dass keine expliziten Regelungen für die Vertretung zugewanderter Personen existieren. Die Gemeindeordnung bietet die Möglichkeit von Beiräten und Ausschüssen lediglich in beratender Funktion. Institutionelle Diskriminierung und institutioneller Rassismus sind insbesondere für Betroffene schwierig zu erkennen und noch schwieriger zu benennen. Oft wird die Diskriminierung mit dem Fehlverhalten Einzelner begründet, gleichzeitig haben Individuen nur bedingt die Möglichkeit, diskriminierende Strukturen zu verändern.
Und wenn man dann halt merkt: egal, was man macht, egal, wo man arbeitet, es reicht dann irgendwie doch vorne und hinten nicht. Und dann, ständig muss man was beantragen […] Ich habe ja dann natürlich überall auch Vergünstigungen gekriegt, das kann man ja alles beantragen, das hieß dann aber auch: Ich muss dann zum Verein rennen, ich muss dann zur Schule rennen, mich überall offenbaren. Und das ist einem dann natürlich irgendwann unangenehm, also ist ja irgendwie logisch. Aber, ja, das würde ich auf jeden Fall sagen, das war schon sehr anstrengend.
Die geschilderten Episoden machen die Verflechtungen von Diskriminierung über verschiedene Ebenen und in der Dynamik der unterschiedlichen Zuschreibungen deutlich. Es sind unausweichliche Fragen der Lebensbewältigung, die hier thematisiert werden: Wie bekomme ich einen Ausbildungsplatz, falls ich Kopftuch tragen möchte? Wie erhalte ich im Jobcenter die richtige Beratung? Wie setze ich mich in der Kita meiner Kinder für mehr Sensibilität im Umgang mit Hautfarbe ein? Wie bekomme ich als Alleinerziehende eine Wohnung? Wie erhalten meine Kinder eine Gymnasialempfehlung? Wie wird meine Stimme in meiner Gemeinde gehört?
